|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z |
|
A
|
|
Abweitung
|
Abstand zwischen zwei 1 Grad auseinander liegenden Längenkreisen des Gradnetzes,
gemessen auf einem Breitenkreis. |
|
Ahming
|
Markierungen in Dezimeter am Vorder- oder Hintersteven eines Schiffes zur
Bestimmung des Tiefgangs. |
|
(AIS) |
Das Automatische Schiffsidentifikations-System (AIS) übermittelt mit einem
Funksystem automatisch
Informationen wie Schiffsname, IMO-Nummer, Rufzeichen, Standort, Kurs, Geschwindigkeit, Ladung
und Reiseziel von Schiffen.
Die AIS-Signale werden auf UKW-Seefunkkanälen in festem Zeitrahmen gesendet. Diese Informationen können von anderen Schiffen empfangen werden. |
|
AIS-AtoN |
Aids to Navigation (Automatische Identifizierungssystem - Navigationshilfen).
Bei dieser Technologie werden Navigationshilfen wie Bojen oder Leuchtfeuer mit
einem AIS-Transponder (Automatic Identification System) ausstattet, um ihre
Position und andere relevante Informationen über UKW-Funk zu übertragen. |
|
Aldislampe
|
Morselampe, nach ihren Erfinder A. Aldis mit der Nachrichten durch
Morsezeichen über kurze Entfernungen übermittelt werden können. |
|
Anker
|
Ein Schiffsanker ist ein Gerät, um ein Boot oder Schiff vorübergehend oder
dauernden auf Grund festzumachen. Ein Anker wird nicht geworfen, sondern
fallengelassen. Um sicher zu ankern, muss eine Relation zwischen Anker (Gewicht
und Bauart), Kettenlänge, Ankergrund, Wind und Strömung hergestellt sein. |
|
Ankerball
|
Schwarzer Signalball, der von ankernden Fahrzeugen am Tage gesetzt wird. |
|
Ankerlicht
|
Weißes Rundumlicht mit einer Tragweite von mindestens 2 sm, dass ein Boot vor
Anker bei Nacht zeigen muss. |
|
Argandsche Lampe
|
Eine von dem Naturwissenschaftler Aimé Argand konstruierter Brenner für
Petroleumlampen mit rundem Hohldocht. Der doppelte Luftzug im
aufgesetztem Glaszylinder sorgte für eine größere Sauerstoffzufuhr.
Somit erhöhte sich die Brenntemperatur und sorgte für ein saubereres
Verbrennen des Brennstoffes. Argandsche Lampe wurde mit zuerst mit
Rüböl, später
mit Steinöl (Petroleum) betrieben. Sie war die
Standardlichtquelle im 19. Jahrhundert. |
|
Astrolabium |
Ein Instrument zur Messung der Sonnenhöhe. Das Astrolabium ist ein Vorläufer des
bereits in der Antike bekannten und von den Arabern entwickelten Sextanten. Es
wurde von mittelalterlichen Seefahrern zur Bestimmung des Breitengrads
verwendet.
Das Astrolabium besteht aus einer Scheibe, die man senkrecht
aufhängt. Die Scheibe ist mit einer Skala und einem drehbaren Lineal, dem
sogenannten Alhidad, ausgestattet. Man dreht das Lineal so, dass die hintere
Spitze mit dem Sonnenschatten übereinstimmt, den die vordere Spitze erzeugt.
Dann liest man auf der Skala den Sonnenstand ab. |
|
Atmosphärische Refraktion |
Dieses Phänomen resultiert aus der normalen Abnahme der atmosphärischen Dichte
von der Erdoberfläche bis zur Stratosphäre. Dies führt dazu, dass Lichtstrahlen,
die schräg durch die Atmosphäre gerichtet sind, gemäß Snells Gesetz zur Erde
gebrochen (oder gebogen) werden. |
|
Aufzugslaterne
|
Aufzugslaternen wurden an einem Mast hochgezogen und konnten zum Auffüllen von
Öl oder Petroleum heruntergekurbelt werden. |
|
B
|
|
Backbord
|
Bezeichnet, vom Heck zum Bug (in Fahrtrichtung)
betrachtet, die linke Seite eines Schiffes. |
|
Bake |
Festes unbefeuertes Seezeichen, dass meist aus einer
Holzkonstruktionen besteht (seltener aus Holz, Stein oder Metall).
Am Tage dient es als Sichtzeichen zum Anpeilen. Baken haben eine
auffällige Form (ähnlich einer Pyramide oder einem Turm). |
|
Bakentonne |
Tonne mit bakenartigem Aufbau. |
|
Befeuerung
|
Ortsfeste Lichtsignale zur Navigation in der Seefahrt bei Nacht. |
|
Beleuchtungsstärke |
Die Beleuchtungsstärke beschreibt die wahrgenommene Helligkeit eines
Leuchtfeuers und wird in der Einheit Lux [𝑙𝑥] angegeben. |
|
Betonnung |
Gesamtheit der Tonnen, die der Sicherung der Schifffahrt dienen. |
|
Betriebslichtstärke
|
Die Betriebslichtstärke eines Leuchtfeuers ist die Lichtstärke, die sich unter
Berücksichtigung des Alterns des Leuchtmittels und durch Verschmutzung der
Leuchte während der Betriebszeit ergibt. Sie wird mit 75 % der
photometrischen Lichtstärke
angegeben. |
|
Blauer Peter
|
Eine Signalflagge, die gesetzt wird, wenn ein Schiff den Hafen binnen 24 Stunden
verlassen wird. |
|
Blaufeuer
|
Signal bei Nacht, wenn ein Schiff einen Lotsen anfordert. |
|
Blinkfeuer
|
Beim Blinkfeuer ist die Dauer der Lichterscheinung kürzer als die
Unterbrechung. Die Blinkdauer beträgt mindestens zwei Sekunden. Es
kommen auch in Gruppen vor, z.B. mit Gruppen von 3 Blink. |
|
Blitzfeuer |
Beim Blinkfeuer ist die Dauer der Lichterscheinung kürzer als die
Unterbrechung. Die Blitzdauer beträgt weniger als eine Sekunde. Es
kommt auch in Gruppen vor, z.B. mit Gruppen von 2 Blitzen. |
|
Blitzlichtstärke |
Die visuell wirksame Lichtstärke eines Blitzfeuers. Sie hängt vom zeitlichen
Lichtstärkeverlauf ab und ist kleiner als das Lichtstärkemaximum. |
|
Blüse
|
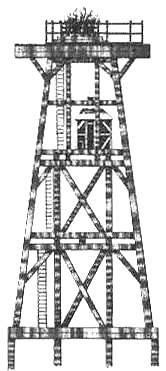 Blüsen waren die Vorgänger der heutigen
Leuchtfeuer die bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts an den
Küsten betrieben wurden. Sie bestanden aus meist aus einem massiven
hölzernen Balkengerüst. Auf einem
Feuerkorb wurde zunächst Holz, dann Steinkohle verbrannt.
Je nach Witterungsverhältnissen
erreichte das Feuer eine Tragweite von 3-8 Seemeilen. Das Feuer
wurde vom Blüser oder Blüsenmeister geschürt. Blüsen waren die Vorgänger der heutigen
Leuchtfeuer die bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts an den
Küsten betrieben wurden. Sie bestanden aus meist aus einem massiven
hölzernen Balkengerüst. Auf einem
Feuerkorb wurde zunächst Holz, dann Steinkohle verbrannt.
Je nach Witterungsverhältnissen
erreichte das Feuer eine Tragweite von 3-8 Seemeilen. Das Feuer
wurde vom Blüser oder Blüsenmeister geschürt. |
|
Bogenlampe
|
Die Bogenlampe arbeitet nach dem Prinzip der selbständigen
Gasentladung. Durch ein starkes elektrisches Feld zwischen den
Spitzen zweier Kohlenstäbe wird die Luft ionisiert und elektrisch
leitend, so dass dort ein heller Lichtbogen entsteht. Die weiß
glühenden Kohlespitzen werden dabei über 4000 Grad heiß. Die
Bogenlampe ist heute durch die Höchstdruckentladungslampe
abgelöst. |
|
Bojen
|
Kleine, meist rote Plastikbällchen, mit denen Schwimmbereiche abgesperrt werden. Nicht zu verwechseln mit
Tonnen. |
|
Brennpunkt
|
Linsen und Hohlspiegel bündeln parallele Strahlen so, dass sie sich
im Brennpunkt schneiden. |
|
Brennweite
|
Der Abstand einer Linse oder eines Hohlspiegels zu ihrem Brennpunkt. |
|
Brückenfeuer |
Markiert mit roten und grünen Festfeuern die Fahrrinnengrenze unter einer
Brücke. Ein weißes Licht kennzeichnet die Mitte der Fahrrinne. |
|
Buhne
|
Im rechten Winkel zum Strandverlauf in das Meer gebauter Damm (z.B.
Quadersteine), um das Ufer vor Brandung oder Strömung zu schützen.
Andere Bezeichnungen sind: Höfte, Kribbe, Schlenge, Stacke. |
|
C
|
|
Candela
|
SI-Basiseinheit der Lichtstärke. Eine gewöhnliche Haushaltskerze hat die
Lichtstärke von 1 cd. |
|
Consolfunkfeuer
|
Funknavigationsverfahren im Langwellenbereich (300 kHz) zur exakten Standortbestimmung auf See. |
|
D
|
|
Dalben
|
In den Hafengrund eingerammte Pfähle zum Befestigen von Schiffen. Andere Bezeichnungen sind Dälben, Duckdalben, Dukdalben oder Dückdalben.
Man unterscheidet:
-
Anlegedalben, Führungsdalben, Abweisdalben zum
Anlegen, Führen und Abweisen von Schiffen
-
Vertäudalben zum Festmachens und Verholen von Schiffen
-
Deviationsdalben zur Erstellung einer Deviationstabelle
|
|
Dalén-Mischer |
Ein Dalén-Mischer ist ein mechanisches Gerät mit Blasebalg, das durch den
Gasdruck aus den Acetylenspeichern angetrieben wird. Es liefert ein Gemisch
aus Luft und Acetylen mit der Eigenschaft, dass die Flamme sauber und heiß
brennt, völlig ohne Ruß. 1909 vom Ingenieur Dalén erfunden. Hergestellt von
AGA AB. |
|
Deckpeilung
|
Man hat eine Deckpeilung, wenn zwei Baken oder zwei Feuer genau
hintereinander (in Deckung) stehen.
|
|
Deviationstonne |
Tonne an einem für die Deviationsbestimmung geeigneten Platz, von dem ein
bestimmtes Festziel auf verschiedenen Kursen gepeilt werden kann. |
|
Dochtbrenner
|
Im Dochtbrenner wird Petroleum am Dochtende vergast und brennt als
Gasflamme. Siehe auch Argandsche Lampe. |
|
Doppelfeuer |
Um Seefeuer zweifelsfrei unterscheiden zu können, wurden zwei gleiche Feuer
nebeneinander aufgestellt. Ein anderer Name ist Zwillingsfeuer. |
|
Doppelpeilung
|
Methode zur Ortsbestimmung durch zweimaliges Peilen desselben Objektes von
verschiedenen Orten. |
|
Doppelwendellampe |
Glühlampe dessen Leuchtdraht nach seiner Aufwicklung zur Einfachwendel nochmals
in Form einer Schraubenlinie aufgewickelt ist. |
|
Drehfeuer
|
Leuchtfeuer, bei dem die Kennung durch Drehung der Optik um eine
vertikale Achse erfolgt. |
|
Drempeltiefe
|
Begriff aus der Schleusentechnik an Kanal- oder Flussschleusen. Der
Drempel ist die Schwelle des Schleusentores, die mit dem Tor
wasserdicht abschließt, um ein Auslaufen der Schleuse zu verhindern.
Der Abstand zwischen Drempel und der Wasseroberfläche wird als
Drempeltiefe bezeichnet. Das Maß bestimmt den maximalen Tiefgang der
Schiffe, die die Schleuse durchfahren können. |
|
Duckdalben
|
siehe Dalben. |
|
Dunkelzeit |
Die Zeitdauer zwischen Ende einer Hellzeit und Beginn der folgenden Hellzeit
eines Leuchtfeuers. |
|
E
|
|
Echolot
|
Elektroakustisches Messgerät zur Bestimmung der Wassertiefe. |
|
EPIRB
|
Eine Notfunkbake (Emergency Position-Indicating Radio Beacon), die
für den Empfang durch Satelliten konstruiert ist. Die EPIRB sendet ein Alarm-
und ein Peilsignal, das den Rettungskräften ein Einpeilen der Notposition
ermöglicht. |
|
F
|
|
Faden
|
Längenmaß in der Schifffahrt. 1 Faden = 6
engl. Fuß = 1,829 m. |
|
Fahrrinne
|
Rinne in Gewässern, die durch entsprechender Betonnung oder Befeuerung als
Fahrwasser gekennzeichnet ist. |
|
Fasstonne
|
Tonnen in Form eines horizontal schwimmenden Fasses. Sie sind meist gelb und werden als Sperrgebietstonnen eingesetzt. |
|
Feet - Fuß
|
Englisches Längenmaß. 1 Feet = 0,314 m. |
|
Festfeuer
|
Lichterscheinung von gleich bleibender Stärke ohne Unterbrechung. |
|
Feuerabstand
|
Horizontaler Abstand zwischen Ober- und Unterfeuer. |
|
Feuerhöhe |
Die Feuerhöhe gibt die Höhe der Lichtquelle eines Leuchtfeuers, im
Tidegebiet über dem mittleren Hochwasser (MHW), sonst über dem
mittleren Wasserstand (MW) an. Sie darf nicht mit der Turmhöhe
verwechselt werden, die lediglich die Höhe des Feuer tragenden
Bauwerkes angibt. |
|
Feuerschiff |
Ein verankertes Spezialschiff als Leuchtfeuer. Bemannte Feuerschiffe wurde durch
Großtonnen oder unbemannte Feuerschiffe (UFS) abgelöst. |
|
Feuerträger
|
Sammelbezeichnung für den mechanischen Träger der Leuchte, also
Leuchtturm, Leuchtbake, Gittermast etc. |
|
Fischerfeuer |
Brennen nur bei Bedarf. |
|
Flackerfeuer |
Lichtsignal (Notsignal) mit Fackeln auf See. |
|
Fresnellinse
|
Die Fresnellinse ist eine flache Stufenlinse. Sie besteht aus einer
zentralen, dünnen sphärischen oder asphärischen Linse, umgeben von
stufenartig angeordneten prismenförmigen Ringzonen, die alle den
gleichen Brennpunkt und annähernd die gleiche Dicke haben wie die
zentrale Linse. Die Fresnellinsen werden zur Bündelung des Lichts
vor allem auf Leuchttürmen und Overhead-Projektoren eingesetzt. |
|
Fresnelscher Apparat
|
Sammelbegriff für alle Leuchtfeueroptiken, die nach dem Prinzip des
von J. A. Fresnel entwickelten Leuchtapparates gebaut wurden.
Es handelt sich um eine Kombination aus mehreren Zonenlinsen, die in
einer drehbaren Anordnung sowohl das Licht konzentrieren als auch
die Kennung erzeugen. |
|
Funkbake
|
Funkbaken dienen als Ergänzung optischer Seezeichen zur Navigation. In der
Seefahrt wird die Funkbake mit der englischen Bezeichnung Radio Beacon (RBN)
bezeichnet. |
|
Funkelfeuer
|
Schnell aufeinander folgende kurze Blitze (50 oder 60 Blitze pro
Minute). Die Blitze kommen auch in Gruppen vor.
Folgen die Funkel nicht ständig aufeinander, sondern werden sie von
einer längeren Verdunkelung unterbrochen, spricht man von einem
unterbrochenen Funkelfeuer. Es kommt auch in Gruppen vor, z.B. mit
Gruppen von 3 Funkel pro Minute.
Das schnelle Funkelfeuer zeigt 100 bis 120 Funkel pro Minute. Es
kommt ebenfalls in Gruppen vor.
Funkelfeuer werden in Seekarten mit "Fkl." oder englisch "Q" für
quick bezeichnet. |
|
Funkfeuer
|
Funkstrahlen mit festgelegten Kennungen, vergleichbar mit den sichtbaren
Leuchtfeuern. Grundsätzlich lassen sich
Funkfeuer in
ungerichtete Funkfeuer, gerichtete Funkfeuer und Drehfunkfeuer
unterteilen. Heute nur noch selten. |
|
Funkpeiler |
Empfangssystem mit Antenne zur Funkpeilung. |
|
G
|
|
Geest
|
Landschaftstyp in Norddeutschland, den nördlichen Niederlanden und
Dänemark, der durch Sandablagerungen während der Eiszeiten
entstanden ist und im Gegensatz zur Marsch steht. |
|
Gegenkurs
|
Ein um 180° entgegengesetzt verlaufender Kurs. |
|
Geographische Sichtweite
|
Größter Abstand aus dem unter Berücksichtigung der Erdkrümmung und der
Strahlenbrechung in der Atmosphäre ein Feuer über den Horizont hinweg gerade
noch gesehen werden kann. |
|
Gleichgängigkeit
|
Zwei Feuer sind gleichgängig, wenn sie gleichzeitig ihre Hellphase
(und Dunkelphase) zeigen. |
|
Gleichtaktfeuer
|
Leuchtfeuer mit gleichen langer Abwechslung von Lichtschein und
Verdunkelung. |
|
Glockentonne |
Bakentonne, die eine Glocke als Nebelschallsender trägt. Die Schläge werden
meist durch die Bewegung der Tonne erzeugt. |
|
Goniometer |
Ein Gerät, das das elektromagnetische Feld in der Nähe des Peilempfängers
nachbildet und durch Drehung eines Geräteteils eine Peilung ermöglicht. |
|
Gösch
|
Kleine Nationalflagge, die am Bug gehisst wird, wenn das Schiff vor Anker oder im Hafen
liegt. |
|
GPS
|
Das Global Positioning System ist ein weltweit, satellitengestütztes
Navigationssystem. Es liefert mittels Laufzeitdifferenzen der
Signale mehrerer Satelliten die exakte Position und Zeit am
Empfangsort. |
|
Gründung
|
In den weichen Marschböden vieler deutscher Küstenregionen müssen
alle schweren Bauwerke zur Sicherung der Standfestigkeit gegründet
sein. Dabei unterscheidet man zwischen Flachgründung und
Tiefgründung. Bei der klassischen Tiefgründung werden Pfähle bis in den
Bereich der festen Bodenschichten getrieben. Bei dem Messturm vor
Spiekeroog waren es 25 Meter. Bei der Flachgründung werden die
Fundamentlasten nur in die oberen Bodenschichten eingeleitet. |
|
Gürtellinse
|
Ring- oder tonnenförmige optische Linse, die das Licht einer Lampe
im Mittelpunkt nach allen Seiten parallel austreten lässt. Eine
Gürtellinse stahlt ein fächerartiges Lichtbündel aus, das Licht wird
angenähert in nur einer Ebene, meist horizontal konzentriert. Bis
360° kann der Ausstrahlungswinkel betragen.
Funktion der Gürtellinse |
|
H
|
|
Hellzeit |
Die Zeitdauer einer in sich geschlossenen Lichterscheinung eines Leuchtfeuers. |
|
Heultonne
|
Auch Heulboje gennant, ist laut tönendes Seezeichen an gefährlichen Stellen. |
|
Hintergrundbeleuchtung |
Die Nennreichweite eines Leuchtfeuers bei Nacht wird ohne Berücksichtigung der
Blendung durch Hintergrundbeleuchtung berechnet. Übermäßige
Hintergrundbeleuchtung durch Straßenlaternen, Neonschilder usw. macht ein
Navigationslicht häufig weniger effektiv und geht in einigen Fällen im
allgemeinen Hintergrundgewirr völlig unter. Ein solches Licht kann auffälliger
gemacht werden, indem man seine Intensität erhöht, seine Farbe ändert oder seine
Taktung variiert. |
|
Höfte
|
siehe Buhne. |
|
Höhe des Feuerträgers
|
An der deutschen Küste gilt für Leuchttürme die Höhe des
Dachfirstes, bei Baken die Höhe des Toppzeichens über dem Erdboden.
Bei
Feuerschiffen wird die Feuerturmhöhe über dem Wasserspiegel
angegeben. |
|
Horizontaler Sehwinkel
|
Horizontaler Winkel (Θ) zwischen Oberfeuer - Beobachterauge -
Unterfeuer, der entsteht, wenn der Beobachter von der Richtfeuerlinie seitlich
abweicht. |
|
Hosenboje
|
Ein hosenartig geschnittenes kräftiges Leinentuch, zum Bergen von
Schiffbrüchigen. |
|
I
|
|
IALA
|
Internationaler Verband der Seezeichenverwaltungen (IALA; engl.: International
Association of Lighthouse Authorities) mit Sitz in Frankeich. Zu den Aufgaben
des IALA gehört die Optimierung und internationale Standardisierung der
Seezeichen. |
|
Internationale Nummer |
Die Nummer die einem Leuchtfeuer zugeteilt ist wird die jeweilige Bandausgabe
vorgesetzt (z.B. C für Ostsee). |
|
K
|
|
Kaap
|
Unbefeuerte Seezeichen vor der Einführung von Leuchtfeuern. |
|
Kabelfeuer
|
Ober- und Unterfeuer bezeichnen ein Unterseekabel, das in der
Richtung der Richtfeuerlinie unterseeisch verläuft. Die Kabelfeuer
kennzeichnen Gebiete, wo das Ankern gefährlich sein.. |
|
Kabellänge
|
185,2 Meter = Zehntel einer Seemeile. |
|
Katadioptrische Optik
|
Optik, die auf Brechung und Reflexion basierend arbeitet. |
|
Kardinalsystem
|
System zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen
mittels richtungsbezeichnender Seezeichen, wie Untiefentonnen,
Kardinaltonnen, Wracktonnen oder Gefahrentonnen. Dabei wird der
Bereich um die Gefahrenstelle in vier Quadranten eingeteilt, die
jeweils einer Himmelsrichtung entsprechen. Diese Gefahrentonnen sind
immer abwechselnd mit Schwarz und Gelb gekennzeichnet. Als
Toppzeichen haben sie zwei schwarze Kegel, die je nach Lage der
Tonne die Richtung angeben. |
|
Kennung
|
Charakteristisches Erkennungszeichen eines Leuchtfeuers bzw. Nebelsignals.
Zur Kennung gehören die Taktung, die charakteristische Abfolge von
Hell- und Dunkelintervallen, deren Wiederkehr, die Dauer zwischen
dem Anfang eines Taktungsmusters und dem Anfang des darauf folgenden
identischen, sowie die Farbe des Feuers. |
|
Kielschwein
|
Anders als der Name vermuten lässt, ist das Kielschwein kein Lebewesen, sondern
ein so genannter Innenträger, der in Längsrichtung über dem Kiel liegt. Dieser
verleiht dem Schiff Längssteifigkeit. |
|
Kimm
|
Die Linie des natürlichen Horizonts. |
|
Klippventil |
Das Klippventil ist ein pulsierendes Ventil für Acetylengas, erfunden 1905 von
Gustaf Dalén, hergestellt von AGA AB. Das Gerät wurde mit Gasdruck betrieben und
portionierte das Gas in "Paketen". Die Mechanik konnte so eingestellt werden,
dass die Leuchtfeuer unterschiedliche Kennungen und unterschiedliche
Periodenlängen zwischen den "Lichtpaketen" erhalten, zum Beispiel Fl 3s (ein
Blitz alle drei Sekunden). |
|
Knoten
|
1,852 km/h bzw. 1 Meridiantertie/Sek. |
|
Kohlenblüse
|
siehe Blüse. |
|
Kohlenbogenlampe
|
Kohlebogenlampen bestehen aus einem Lichtbogen hoher Leuchtkraft
zwischen 2 Kohlestäben, an denen eine hohe elektrische Spannung
liegt. Der Lichtbogen wird durch Berühren der Kohlestäbe gezündet und durch
einen Regler auseinandergezogen, bis sich die optimalen Lichtwerte ergeben. Es gab früher erst Gleichstrombogenlampen, später wurden auch
Wechselstrombogenlampen entwickelt. |
|
Kompassstrich |
Winkeleinheit am Kompass, 1 Kompassstrich = 11,25° (1/8 von 90°) |
|
Konkurrierende Lichter |
Bei der Berechnung der notwendigen Lichtstärke eines Leuchtfeuers müssen die
Lichter Dritter wie z.B. die Hintergrundaufhellung von Beleuchtungsanlagen
berücksichtigt werden. |
|
Krähennest
|
Ausguckstand im Schiffsmast. |
|
Krängung
|
Neigung eines Schiffs zur Seite |
|
Kribbe
|
siehe Buhne |
|
Kugeltonne |
Tonne, deren oberer Teil des Schwimmkörpers (über der Wasserlinie) oder deren
größerer Teil des Aufbaus kugelförmig ist. |
|
L
|
|
Lampenwechselvorrichtung
|
Die Vorrichtung schwenkt eine Reservelampe automatisch in den Brennpunkt
der Linse und zündet sie, falls die Lampe eines Feuers ausfällt. |
|
Landmarke
|
Landmarken sind entweder natürlich Gegebenheiten der Küste, wie etwa auffällige
Grabhügel, Berge, Dünen und einzeln stehende Bäume oder Bauwerke, die primär
nicht für nautische Zwecke errichtet wurden, wie etwa Kirchtürme. |
|
Landradarkette
|
Eine Landradarkette besteht aus mehren Radarstationen, die teilweise
auf Leuchttürmen angebracht sind. Alle Ortungsdaten werden in einer
Revierzentrale zusammengefasst und von dort der Schifffahrt über
Revierfunk übermittelt. |
|
LAT
|
Lowest Astronimical Tide = niedrigstmöglicher Gezeitenwasserstand |
|
Lee
|
Die vom Wind abgekehrte Seite. |
|
Leinen
|
Schon seit Beginn der Seefahrerzeit entwickelte sich an Bord der Schiffe eine eigene
seemännische Sprache, die noch heute verwendet wird. Die Seemannssprache hat
ihren Ursprung vor allem im Bedürfnis nach Sicherheit. Um mehrdeutige
Bezeichnungen zu vermeiden war es zum Beispiel notwendig, nicht einfach von
einem "Seil" zu sprechen, sondern es nach Funktion und Art genauer zu
bezeichnen: "Leinen", "Tampen", "Festmacherleinen" und "Drähte". |
|
Leitfeuer |
Das Leitfeuer bezeichnet die Fahrrinnenachse durch einen schmalen,
weißen Lichtsektor. Die beiden äußeren Warnsektoren zeigen
durch die Farbe (grün - rot) die Kursabweichung an. |
|
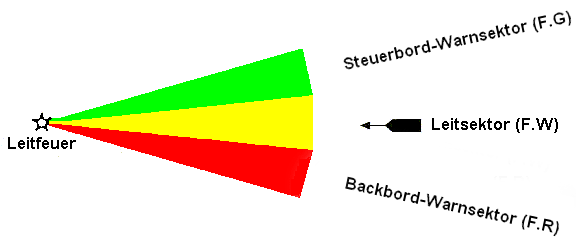 |
|
Leuchtbake
|
Bake mit Befeuerung. |
|
Leuchtfeuerverzeichnis
|
Amtliches Verzeichnis vom Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie. |
|
Leuchttonne
|
 Schwimmendes und leuchtendes Schifffahrtszeichen, dass früher mit Gas und heute
mit LED-Laternen und Solarkollektoren betrieben wird. Schwimmendes und leuchtendes Schifffahrtszeichen, dass früher mit Gas und heute
mit LED-Laternen und Solarkollektoren betrieben wird. |
|
Lichtstärke |
Die Lichtstärke beschreibt die abgestrahlte Helligkeit eines Leuchtfeuers und
wird in der Einheit Candela [𝑐𝑑] angegeben. |
|
Lichtstrom |
Die von einer Lichtquelle ausgestrahlte Lichtleistung. Die Einheit ist Lumen
(lm). |
|
Luftfahrtfeuer |
Markierung von Sendetürmen, Kaminen oder andere Hindernisse für die Luftfahrt.
Ihrer Kennung wird immer das Wort "Aero" vorgestellt. |
|
Luv
|
Die dem Wind zugewandte Seite. |
|
M
|
|
Marina
|
Yachthafen. |
|
Markenfeuer
|
Funkbake an Hafeneinfahrt oder Molenkopf. |
|
Marschland
|
Nährstoffreicher, feuchter Boden im Schwemmland der
nordwestdeutschen Küsten der im Gegensatz zur Geest steht. |
|
Meilenbake |
Baken zur Bezeichnung einer genau gemessenen Meile im Fahrwasser zum
Meilenlaufen (Geschwindigkeitsmessung). |
|
Membransender
|
Eine Membrane wird mit Wechselstrom in Schwingungen versetzt, die wiederum auf
die Luft übertragen werden. In einigen Nebelsignalanlagen werden mehrere
Membransender in Schallwänden angeordnet. |
|
Meridiantertie
|
Der 60. Teil einer Meridiansekunde (0,5144 m). |
|
Mischfeuer
|
Kennung eines Leuchtfeuers, welches aus Kombination von Blitzen,
Blinken und Unterbrechungen bestehen kann. |
|
Moiréfeuer
|
 Das Moiré-Feuer ist kein Leuchtfeuer mit einer Optik, sondern ein
viereckiger Kasten, der ein permanentes, meist orangenes Licht
ausstrahlt. Es wird meist zur Bezeichnung von Ankergrenzen,
Sperrgebieten oder Einfahrten benutzt, wenn für eine Kombination von
Ober- und Unterfeuer hintereinander zu wenig Platz ist. Das Moiré-Feuer ist kein Leuchtfeuer mit einer Optik, sondern ein
viereckiger Kasten, der ein permanentes, meist orangenes Licht
ausstrahlt. Es wird meist zur Bezeichnung von Ankergrenzen,
Sperrgebieten oder Einfahrten benutzt, wenn für eine Kombination von
Ober- und Unterfeuer hintereinander zu wenig Platz ist. |
|
Molenfeuer
|
Kennzeichnet die Hafeneinfahrt, Grün auf der
Steuerbordseite und Rot auf der Backbordseite. |
|
Morsefeuer
|
Die Taktung eines Morsefeuers entspricht einem Buchstaben des
Morsealphabets. |
|
N
|
|
Natriumdampflampe
|
Durch die Gasentladung von Natriumdampf kommt es zu einer Emission
von gelbem, praktisch monochromatischem Licht. Wegen der hohen
Lichtausbeute wird sie deshalb als Straßen- und Hafenbeleuchtung
verwendet, auch weil das langwellige Licht Nebel und Dunst gut
durchdringt. |
|
Nautische Meile
|
= Seemeile (1852 m) |
|
NAVTEX |
Das Navigational Telex System
ist ein internationaler Informations- und Warndienst zur Verbreitung nautischer
und meterologischer Warnungen im Küstenbereich bis 200 sm Abstand. |
|
Nebelschallsender |
Sender zum Geben eines Luft-Nebelschallzeichens oder eines
Wasser-Nebelschallzeichens. |
|
Nebelsignalstation
|
Wenn es im optischen Bereich durch Nebel oder Niederschlag unmöglich
ist, ein Feuer auszumachen, dann wird meist automatisch das
Nebelsignal angestellt. Es gibt verschiedene Techniken Einrichtung
zum Senden von Luftschallsignalen. Membransender (Horn), elektrische Nautophon,
Sirenen, Glockenschläge, durch Druckluft betriebene Einrichtungen
können ein Nebelsignal zu seinem Ton verhelfen. Ende des 19. Jahrhunderts kamen
Nebelsignalkanonen zum Einsatz. |
|
Nebenfeuer |
Ein Hilfsfeuer, das sich im selbem Feuerträger wie das Hauptfeuer befindet und
dessen Licht niedriger angebracht ist als das des Haupfeuers. |
|
Nenntragweite
|
Tragweite eines Leuchtfeuers bei festgelegten
Witterungsbedingungen. Die Nenntragweite ist in der Regel größer als die
nautisch nutzbare Tragweite. |
|
NGA
|
Die National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ist eine
US-amerikanische Behörde für militärische, geheimdienstliche und auch
kommerzielle kartografische Auswertungen und Aufklärung mit Hauptsitz in
Bethesda, Maryland. Die NGA erstellt und veröffentlicht Listen über Leuchtfeuer,
Funkhilfen und Nebelsignale in sieben Bänden, die geografisch gegliedert sind.
Es werden auch Sturmsignale, Signalstationen, Funkpeiler, Funkfeuer und RACONs
aufgeführt. |
|
Nutzabstand / Nutzweite
|
Abschnitt einer Richtfeuerlinie, in dem die Richtfeuerlinie zur Deckpeilung
genutzt werden kann. Er wird begrenzt durch den kürzesten (K) und längsten (L)
Nutzabstand zum Unterfeuer. Die Nutzweite (N) ergibt sich aus dem längstem und
kürzestem Nutzabstand (N = L − K). |
|
O
|
|
Oberfeuer
|
siehe Richtfeuer. |
|
Ordnung
|
Einteilung der Größe von Zonen- und Gürtellinsen nach ihrer
Brennweite, beginnend mit 1. Ordnung als größte und 6. Ordnung als
kleinste Ausführung. |
|
Orientierungsfeuer
|
Leuchtfeuer, dass die Bestimmung des Schiffsorts durch Anpeilen
ermöglicht. |
|
Otterblende
|
Vor einer Leuchte senkrecht
stehende, jalousieartige Lamellen, die durch eine Mechanik zur
Erzeugung der Kennung auf- und zu geklappt werden. Dadurch erzeugen
sie die Kennung des Leuchtfeuers. |
|
P
|
|
Parabolspiegel |
Schalenförmiger Hohlspiegel, von dessen Brennpunkt aus die Strahlen einer
Lichtquelle parallel nach außen reflektiert werden. |
|
Pegel
|
Vorrichtung zur Bestimmung des Wasserstandes. Ist an vielen Brücken,
Schleusen und in Häfen zu sehen. Der Latten-Pegel ist ein Stab mit
Maßeinteilung, der Schwimmer-Pegel (Pegeluhr) eine Messanordnung,
deren Zeiger von einem Schwimmer bewegt wird. Automatomatische
Aufzeichnungen liefert der Schreib-Pegel (Limnigraph). |
|
Peilscheibe |
Zum Einsatz kommen die meist fest montierten Peilscheiben für die Seitenpeilung,
um den Standort eines Schiffes durch Anpeilen von Landmarken zu bestimmen. |
|
Photometrische Lichtstärke
|
Die photometrische Lichtstärke eines Leuchtdeuers ist die Lichtstärke, die aus
photometrischen Messungen an Lampe und Leuchte oder durch Rechnung ermittelt
wird. |
|
Pfahlrost
|
Ein Pfahlrost ist eine Tiefgründung was auch beim Bau von
Leuchttürmen verwendet wurde. Er besteht aus der Pfahlgruppe und der
Rostplatte. Das zu gründende Bauwerk wird auf der Rostplatte
errichtet. Diese übernimmt die Bauwerkslasten und verteilt sie auf
die einzelnen Pfähle. Je nach der Höhenlage der Rostplatte über der
Bodenoberfläche unterscheidet man tiefe und hohe Pfahlroste. Quelle: www.karl-gotsch.de |
|
Ponton
|
Kastenförmiger großer Schwimmkörper, der als schwimmender Anlegesteg
für Boote und Schiffe genutzt wird. |
|
Positionslampen
|
Vorgeschriebene Seitenlichter und Hecklicht, die anderen Verkehrsteilnehmern die
Fahrtrichtung des Schiffs signalisieren.
- In Fahrtrichtung rechts vorne
(steuerbord): grün
- In Fahrtrichtung links vorne
(backbord): rot
- Nach hinten (achteraus): weiß |
|
Präzisionssektorfeuer
|
Sektorfeuer mit hoher Lichtstärke, dessen Sektoren auch in großer Entfernung noch scharfe Grenzen haben.
Es wird vorwiegend für lange
Richtfeuerlinien angewendet. |
|
Pricke
|
Fünf bis sieben Meter hohe Birken mit Zweigbüscheln, die im Wattenmeer schmales
und flaches Fahrwasser kennzeichnen. |
|
Prismenkorb |
Bezeichnung für eine große Fresnellinse. |
|
Q
|
|
Quermarkenfeuer
|
Das Quermarkenfeuer gibt mit einem quer zum Kurs verlaufenden Sektor
an, dass von hier ab einem neuen Leit- oder Richtfeuer gefolgt
werden soll. Dieser Kursänderungssektor zeigt in der Regel ein rotes
oder grünes Festfeuer und wird meist beidseitig durch
Ankündigungssektoren begrenzt. |
|
R
|
|
Radarreflektoren
|
Winkelreflektoren aus Metall, die einfallende Radarimpulse besonders
stark zurückstrahlen und damit Baken und Leuchtfeuer schon auf große
Entfernung radarsichtbar machen. |
|
Reeden |
In Seekarten eingetragene Wasserflächen zum Ankern. |
|
Richtbaken |
Baken, die zu zweien durch Deckpeilung oder zu mehreren durch Symmetriewirkung
eine Linie auf See oder im Fahrwasser markieren. |
|
Richtfeuer |
Ober- und Unterfeuer, die durch Deckpeilung einen Kurs im Fahrwasser
zwischen Untiefen bezeichnen.
Richtfeuer werden verwendet, wenn Leitfeuer nicht präzise genug sind, vor allem
bei sehr engen Fahrrinnen.
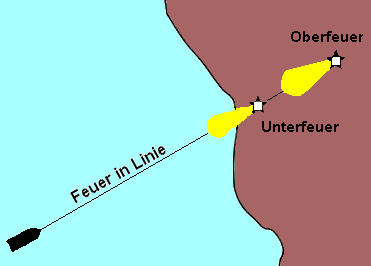 |
|
Richtfeuerlinie
|
Eine Richtfeuerlinie besteht immer aus dem Unterfeuer und dem
Oberfeuer. Sie werden in der Regel auch am Tage im unbefeuerten Zustand als
Richtmarken bzw. Richtbaken verwendet. |
|
Richtfunk |
Funkverkehr von Punkt zu Punkt mit Hilfe von Richtfunkantennen. |
|
Rüböllampe
|
Rüböl aus geschrotetem Samen von Raps und Rüben wurde früher für
Leuchtfeuer verwendet, aber später durch Mineralöl verdrängt, da es
billiger war. |
|
S
|
|
Schlenge
|
siehe Buhne |
|
Seefeuer
|
Leuchtfeuer, dass die Bestimmung des Schiffsorts durch Anpeilen
ermöglicht. |
|
Seelaterne |
Laterne, die für den speziellen Einsatz auf einer Leuchttonne ausgebildet ist. |
|
Seekartennull
|
Nullniveau der auf Seekarten angegebenen Tiefen. Bei der Ostsee der
mittlere Wasserstand, bei der deutschen Nordsee das niedrigste nach
astronomischen Einflüssen mögliche Niedrigwasser. |
|
Seemannsgarn
|
Schon ewig gibt es Geschichten über Klabautermänner und Meerjungfrauen und
skurrile Geschichten vom Schiff. Im Volksmund nennt man das auch "Seemannsgarn
spinnen". Der Begriff stammt aus der Seefahrt, denn früher mussten die Matrosen
der Segelschiffe – wenn Zeit war oder Flaute herrschte - Seemannsgarn spinnen.
Das ist dünnes Kabelgarn aus altem Tauwerk zum Bekleiden der Trossen und Taue.
Dabei erzählte man sich gerne "Döntjes" (plattdeutsche Anekdoten) und
Geschichten. Diese waren oft langatmig, voller Prahlereien und ohne jeglichen
Tiefgang. Wenn es dann wieder nach Hause ging und der Seemann seinen Freunden
und Bekannten die Geschichten von den Abenteuern mit Meeresungeheuern, Piraten
und Klabautermännern zum Besten gab, hingen die Zuhörer gespannt an den Lippen
des Erzählers. |
|
Seemeile
|
1 Seemeile = 1852 Meter. |
|
Seezeichenversuchsfeld |
Ältere Bezeichnung für Seezeichendienst beim Wasser- und Schifffahrtsamt. |
|
Sehschärfe |
Der kleinste Winkel, unter dem neben- oder übereinander liegende Punkte von
einem Auge noch getrennt wahrgenommen werden können. |
|
Seidenglühstrumpf
|
Der österreichische Erfinder, Carl Auer von Welsbach, entwickelte
1885 den chemisch behandelten Seidenglühstrumpf, der in einer
Gasflamme aufleuchtet, zuerst mit Petroleumvergasung, später auch
mit anderen Gassorten. |
|
Sektorenfeuer |
Ein Leuchtfeuer, bei dem die Kennung je nach Sektor unterschiedlich
ist. siehe: Leitfeuer |
|
Semaphor
|
Ein Signalmast mit verstellbarem Flügelsignal der früher zur
optischen Zeichengebung, im wesentlichen zum Anzeigen von Windstärke
und Windrichtung, an der Küste benutzt wurde. |
|
Senkkasten
|
Ein Kasten, der meist mit Beton gefüllt auf den Grund abgesenkt
wird, um dann als Fundament für Aufbauten zu dienen. (auch
französisch Caisson) |
|
Sextant
|
Winkelmessgerät zur Bestimmung des Schiffsortes. |
|
Sigma
|
In der Leuchtfeuertechnik das Maß für die Eintrübung der Sicht. |
|
Spiegeldrehfeuer |
Eine oder mehrere auf einem Drehteller angeordnete Lampen mit Hohlspiegel. Die
Kennung des Leuchtappartes entsteht durch die Drehgeschwindigkeit und die Anzahl
der Lampen. |
|
Spierentonne
|
Spierentonnen haben die Form einer Spiere (dicke Stange oder Balken), sind immer
rot mit geraden Zahlen, die die Backbordseite (links, stromaufwärts) des
Fahrwassers kennzeichnen. |
|
Spitztonne
|
Grüne Tonne mit ungeraden Zahlen, mit der die Steuerbordseite (rechts,
stromaufwärts) des Fahrwassers gekennzeichnet wird. |
|
Squat |
Tiefgangsunterschied des gestoppten und des in Fahrt befindlichen Schiffes. |
|
Stacke
|
siehe Buhne. |
|
Steuerbord
|
Steuerbord bezeichnet, vom Heck zum Bug (in Fahrtrichtung)
betrachtet, die rechte Seite eines Wasser-, Luft- oder Raumfahrzeugs |
|
Stockanker
|
Der klassische Stockanker, früher auch als Admiralitätsanker bezeichnet, wird
heute praktisch nicht mehr benutzt. Er hält überwiegend dadurch, dass der quer
zum Schaft stehende Stock den Anker dreht, sodass sich ein Flunken in den Grund
bohrt. |
|
Stölpe
|
Eine Stöpe ist eine verschließbare Deichdurchfahrt, die künstlich angelegt ist,
um eine Verbindung zu einem Koog zu schaffen. |
|
Stumpftonne |
Tonne, deren sichtbarer Teil ganz oder annähernd die Form eines stehenden
Zylinders hat. Die obere Fläche ist abgeplattet (stumpf). |
|
T
|
|
Tagesmarke
|
Unbeleuchtete Tagesseezeichen. |
|
Tagfeuer
|
Leuchtfeuer, das auch tagsüber brennt. |
|
Taktung |
Bei Leuchtfeuern die zeitliche Abfolge der Lichterscheinung eines getakteten
Lichtes. |
|
Tonnen
|
Schwimmende Seezeichen, die Fahrwasser definieren oder Gefahrenstellen kennzeichnen.
Nicht zu verwechseln mit Bojen. |
|
Tonnenleger |
Seezeichenfahrzeug, das für den vorwiegenden Einsatz zur Wartung von Tonnen
ausgerüstet ist. |
|
Toppzeichen
|
Tagessichtzeichen auf Baken und Tonnen. Die Formen sind: Kegel, Zylinder, Kugel oder Kreuz. |
|
Torfeuer
|
Torfeuer sind zwei Feuer gleicher Feuerhöhe, gleicher Lichtstärke
und gleicher Kennung, die zu beiden Seiten der Fahrwasserachse
einander genau gegenüber (rechtwinklig zur Fahrwasserachse) und von
der Fahrwasserachse gleichweit entfernt angeordnet sind. |
|
Tragweite
|
Die optische Tragweite (Reichweite) ist der Abstand, in dem ein Leuchtfeuer bei
guter Sichtigkeit mit bloßem Auge bei Nacht gerade noch wahrnehmbar
ist. Sie ist bei Leuchtfeuern von der Betriebslichtstärke, von dem
Schwellenwert der Augenempfindlichkeit und dem Sichtigkeitsgrad der
Luft abhängig. |
|
Trägerfrequenz |
Hochfrequente Schwingung, auf die eine Schwingung niederer Frequenz aufmoduliert
wurde. |
|
Transmissionsgrad |
Bezeichnung der Reflektions- und Absorbtionsverluste im Leuchtfeuer durch einen
Farbfilter. |
|
U
|
|
Uferfeuer
|
Mehrere Leuchtfeuer die den Verlauf eines Ufers kennzeichnen. Oft
als Laternenmasten, mit gelblich leuchtenden Natriumdampflampen. |
|
Ultra-Funkelfeuer
|
Leuchtfeuer mit mehr als 160 Blitzen pro Minute. |
|
Unterfeuer
|
siehe Richtfeuer. |
|
V |
|
Verkehrstrennungsgebiet |
Schifffahrtswege, die durch Trennlinien oder Trennzonen in Einbahnwege getrennt
sind und jeweils nur in Verkehrsrichtung rechts befahren werden dürfen. |
|
W
|
|
Wahrschau
|
Lichtsignalstelle bzw. Warneinrichtung. |
|
Wechselfeuer |
(Alternating lights“
Verschiedenfarbige Lichterscheinungen werden abwechselnd gezeigt.
Zur weiteren Unterscheidung erhalten die Lichtquellen verschiedene
Farben (weiß, grün, rot) und andere Kennungen nach festgelegten
Befeuerungsgrundsätzen. |
|
Wechselvorrichtung |
Auf einem Drehtisch befinden sich zwei oder vier Glühlampen. Bei Ausfall der
Glühlampe im Brennpunkt wird automatisch eine Reservelampe in den Fokus gedreht. |
|
Wiederkehr
|
Der Zeitraum vom Einsetzen einer Taktkennung bis zum Einsetzen der
nächsten gleichen Taktkennung eines Leuchtfeuers. |
|
Winkbake |
Holzgestell oder Türmchen mit einem schwenkbaren Mast. Dieser
optische Signalgeber gab bei widrigem Wetter ohne Lotsen segelnden
Schiffen den zu steuernden Kurs an, man winkte die Schiffe in den
Hafen herein. |
|
Wippfeuer
|
Kohlenblüse bei dem der Feuerkorb über einen langen Balken mit
Gegengewicht in die Höhe geschwenkt wurde. So konnte das Feuer
leicht in Gang gehalten werden. Diese Feuerwippen waren gegen Ende
des 16. Jahrhunderts sehr verbreitet und wurden in bedeutender Größe
ausgeführt, so dass sie den Feuerkorb 10 m und mehr über den
Standort hoben. Der Korb konnte allerdings nur mäßige Größe haben,
sodass er in den langen Nächten und bei starkem Wind mehrfach
gefüllt werden musste. |
|
Z
|
|
Ziehlaterne
|
Eine Laterne, die nachts an einer Holzbake hochgezogen wurde. |
|
Zonenlinse
|
Eine Linse, auf der konzentrische Ringe angebracht sind. Die Zonen
unterscheiden sich in ihrer Transparenz und in ihrer optischen Weglänge. |
|
Zünd- und Löschuhr |
Sie diente bei Leuchtfeuern zur selbsttätigen Ein- und Ausschaltung der
Gaszufuhr. |
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z |